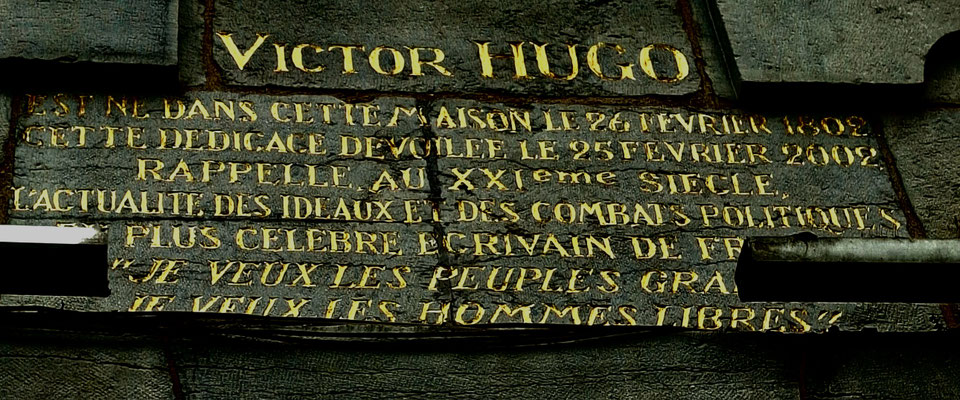Durch die Grüne Stadt, die nicht nur die Zeit misst
Besançon ist geprägt von römischen Anfängen, Vaubans UNESCO‑Zitadelle und einer Uhrmachertradition, die heute in Mikro‑ und Nanotechnologie weiterlebt. Eine Replik auf unsere Reise in den Osten Frankreichs Ende Juni 2025.

An einem frühsommerlichen Morgen hängt ein wenig Dunst über dem Doubs, als hätte jemand einen sanften Schleier über die sieben Hügel gelegt, die Besançon umringen. Unten glitzern die Steine der Renaissancefassaden, während erste Radfahrer lautlos vorbeiziehen. In dieser Flussschleife, die Julius Cäsar als „wie mit dem Zirkel gezogen“ beschrieb, schlägt seit zweitausend Jahren ein urbanes Herz, das die Zeit misst – zuerst mit Sonnenuhren und Turmwerken, später mit feinsten Kalibern, heute mit Chips und Sensoren im Mikrometerbereich. Zwischen Bastionen, Brücken und Baumalleen atmet die Stadt Geschichte, ohne je museal zu wirken...

Reiche Geschichte:
Als keltisch‑römisches Vesontio wurde der Ort wegen seiner natürlichen Befestigung durch die Flussschleife geschätzt; im Mittelalter behauptete Besançon den Status einer Reichsstadt im Heiligen
Römischen Reich.
Nach 1678 wurde die Stadt französisch und durch Festungsbaumeister Vauban monumental ausgebaut; Zitadelle und Befestigungen zählen heute zum UNESCO‑Welterbe des Vauban‑Netzwerks.
Die Uhrenindustrie machte Besançon im 19. und 20. Jahrhundert zum Zentrum französischer Uhrmacherei; Krisen der 1970er führten zur Umstrukturierung, doch das Know‑how trug die Mikrotechnik und Präzision weiter.

Die Grüne Stadt heute
Als Universitätsstadt mit rund 21.000 Studierenden prägt eine junge Bevölkerung Kultur, Forschung und Alltag; das zeigt sich in Festivals, Museen und einem dicht vernetzten Kreativ‑ und Start‑up‑Milieu.
Die Zitadelle dient heute als Panorama‑ und Kulturort mit Ausstellungen und Parkanlagen; Spazierwege auf den Mauern bündeln Stadt-, Fluss- und Hügellandschaft zu einem urbanen Amphitheater.
An der Doubs‑Promenade treffen Wochenmärkte auf Radwege und Flussboote; die kompakte Topographie lädt zum Gehen ein, während Parks und Ufer die Lebensqualität im Alltag prägen.
Im Rathaus amtiert nicht nur eine Bürgermeisterin von der Grünen Partei, sondern die Stadt zeigt sich überall von der grünen Seite. Es sind die vielen Hügel und die Schleife des Doubs, die die Stadtlandschaft prägen, aber auch die zahlreiche Parks, Flussuferwege und Naturräume, die sich direkt mit dem urbanen Gefüge verknüpen.
Die Hauptstadt der Zeit:

Besançon gilt seit dem 19. Jahrhundert als die französische Hauptstadt der Uhrmacherei und als Hüterin präziser Zeitmessung, getragen von einer einzigartigen Verbindung aus Handwerk, Wissenschaft und Industrie, die bis heute nachwirkt. Herzstück dieser Tradition ist das Observatoire Chronométrique de Besançon, das bis heute als unabhängige Instanz Chronometer prüft und zertifiziert.
Die moderne Uhrenindustrie Besançons entstand ab 1793, als der Genfer Laurent Mégevand mit Dutzenden Schweizer Uhrmachern in die Stadt kam und dort die industrielle Fertigung begründete. Binnen weniger Jahrzehnte entwickelte sich daraus die „Capitale française de l’horlogerie“. Um 1880 stammten bis zu 90 Prozent aller in Frankreich produzierten Uhren aus Besançon; trotz Krisen in den 1890ern und 1930ern blieb die Stadt ein Zentrum, bis die 1970er‑Jahre (Ölkrise, Quarz-Umbruch) die großen Firmen schwer trafen. Gleichwohl hielten Marken wie Lip und Yema, das Musée du Temps, die Uhrmacherschule und Industriebetriebe die Kompetenz vor Ort lebendig und prägen das städtische Gedächtnis bis heute.
Über 200 Jahre Know-how in Mechanik und Mikromechanik, ein dichtes Netz aus Schulen, Museen und Unternehmen sowie neue Projekte internationaler Luxus- und Uhrenmarken sichern die Erneuerung der lokalen Kompetenz. Nach der industriellen Blüte bis in die 1970er erlebt Besançon eine qualitätsgetriebene Renaissance mit Mikromechanik, Kleinserien und Restaurierung, die internationale Marken und unabhängige Uhrmacher:innen anzieht. Die UNESCO‑Würdigung stärkt Ausbildung, Nachwuchsgewinnung und Sichtbarkeit und verankert die Zeit- und Uhrmacherkultur langfristig im Jura‑Bogen, mit Besançon als französischem Ankerpunkt.
Das Foucaultsche Pendel:

Das Foucaultsche Pendel in Besançon befindet sich im Musée du Temps (Palais Granvelle) und demonstriert dort anschaulich die Erdrotation, indem die Schwingungsebene relativ zum Boden mit Winkelgeschwindigkeit die geographische Breite ist. In mittleren Breiten dauert eine volle Drehung der Schwingungsebene etwa 30–32 Stunden; die berühmte historische Vorführung erfolgte 1851 im Pariser Panthéon mit einem 67‑Meter‑Pendel.
Das Pendel ist Teil der Dauerausstellung des Musée du Temps, das im Renaissance‑Palais Granvelle an der Grande Rue untergebracht ist; es verbindet lokale Uhrmachertradition mit physikalischen Zeitmess‑Exponaten vom Sonnenuhr‑ bis zum Atomzeitalter. Von diesem Turm hat einen wunderbaren Rundblick auf die Stadt.